![]()
STASIOPFER
Aufarbeitung von MfS- Unrecht
![]()
Medienberichte
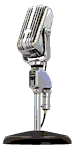
"Demokratie funktioniert nur, wenn alle mitmachen" – das gilt allerdings auch für Diktaturen
Erinnerungen an die DDR
Von den richtigen Gefühlen im falschen Staat:
Jeder hat das Recht, sich seiner eigenen Geschichte bewusst zu werden
Im vergangenen Jahr wurde ich verschiedentlich gefragt, wie es mir gelungen
sei, so frei und leicht über meine Kindheit in der DDR zu schreiben, wo ich
doch unter Staatsfeinden groß wurde (oder wen der Machtapparat dafür hielt)
und also mit all den Konsequenzen vertraut war, die dieses Umfeld in der
ostdeutschen Diktatur mit sich brachte. "Sie erzählen ganz ohne Bitterkeit
davon - als wäre es eine glückliche Zeit gewesen." Die Wahrheit ist, es war
eine glückliche Zeit, auch wenn mir die politische Sachlage als Kind keine
Zeit ließ für einen naiv verträumten Blick auf den Realsozialismus. Aber ich
war glücklich, weil ich mit den Menschen zusammen war, die ich liebte, weil
Westschokolade nicht alles im Leben ist und weil mir dieser Staat, der
seinen Bürgern nicht wohlgesinnt war, am Ende doch nichts anhaben konnte.
Ich bin mehr als glimpflich davongekommen.
Sicher hätten die äußeren Umstände leichter sein können für mich, wäre ich
angepasster DDR-Durchschnitt gewesen, mit Eltern in der Partei, FDGB-Urlaub
in Kühlungsborn und einer Dreizimmerwohnung in Marzahn. Aber ich glaube
nicht, dass sich mein Glückspotenzial dadurch vergrößert hätte. Im
Gegenteil. Viel furchtbarer als das Ertragen von Duckmäusern, Denunzianten,
Pionierleitern, Parteisekretären und Parolenwiederkäuern scheint mir heute
die Vorstellung, ein Teil von ihnen zu sein. Ich bin dankbar, dass mir das
erspart blieb - nicht nur, weil mein Leben selbst unter Bewachung und
Reglementierung vermutlich deutlich fröhlicher und hedonistischer war als
das der meisten Mitmacher. Vor allem der beklemmend dumpfe Geist der späten
DDR lässt mich immer noch schaudern. Ich schwöre, es ist wahr: Im Frühsommer
1989 antwortete ein DDR-Student ohne jede Ironie auf die Frage, warum er
Platon für einen idealistischen Philosophen halte: "Weil er die führende
Rolle der Arbeiterklasse nicht erkannt hat." Das ist die bittere Wahrheit
über die letzten Jahre vor der Wende: Trivialität, Gedankenlosigkeit,
Desinteresse.
Aber wer erinnert sich heute schon gern daran, wenn er zurückdenkt? Man
mag's ja kaum noch aussprechen, das böse Wort mit O, aber an dieser Stelle
ist jetzt kein Entrinnen mehr. Denn eins wurde beim Phänomen Ostalgie
beharrlich ignoriert: eine differenzierte Beschreibung dessen, was sich
hinter diesem griffigen Schlagwort eigentlich verstecken soll.
Staatsbürgerliche Wehmut, würde ich vermuten. Aber wenn Ostalgie das
Zurücksehnen nach der DDR sein soll, dann verstehe ich nicht, wie sich
Wolfgang Becker mit "Good Bye, Lenin", der ja nun wirklich bei jeder
Gelegenheit genannt wurde, dessen verdächtig machen konnte. "Good Bye,
Lenin" ist kein heimwehkranker Retrofilm, sondern ein feinsinniges und
liebevolles Stück über Menschen in einer Ausnahmesituation. Wenn überhaupt,
wird erzählt, was dieser Staat hinterlassen hat im Leben seiner Bürger. Oder
ist im 14. Jahr der Wiedervereinung die Arroganz schon so weit gediehen,
dass bloßes Zurückdenken an Erlebnisse im untergegangenen Reich als
ostalgischer Akt gilt? Sind richtige Gefühle im falschen Staat unerlaubt?
Das wäre anmaßend. Jeder hat das Recht, sich an seine eigene Geschichte zu
erinnern. Auch Ossis. Ausschlaggebend scheint mir in diesem Erinnerungswust
nicht, dass, sondern wie man sich erinnert. Denn der Blick auf das Private
ist das eine, die Verharmlosung eines menschenverachtenden Systems etwas
ganz anderes. Hier scheint mir der Kern des ostdeutschen Pudels zu liegen.
War doch nicht alles schlecht. Das Problem an diesem Satz ist, dass er
eigentlich meint: War doch alles gut. Aber das war's nicht.
Erinnerungsfähigkeit hängt offenbar sehr von der Seite ab, auf der man einst
stand. Wenn Katarina Witt sich ungerührt im Blauhemd auf die RTL-Couch
setzt, dann zeigt uns das vor allem ein mangelndes Maß an Selbstreflexion.
Ich hätte sie für weniger hemmungslos gehalten. Zumindest stünde es ihr
besser an. Aber Demut ist bekanntlich nicht die hervorragendste Eigenschaft
derer, die ohne Zweifel sind. Da ist Goldkati nicht die Einzige. Der Lehrer,
der mich 1981, ich war gerade zehn Jahre alt, öffentlich zur faschistischen
Agentin stempelte, weil ich den Aufnäher "Schwerter zu Pflugscharen" trug,
der unterrichtet heute noch an derselben Schule. Und nicht irgendwas, nein,
politische Bildung! Was soll man dazu sagen? Am besten, man schnauft
verächtlich in sich hinein. Denn das ist kein Treppenwitz der Geschichte,
das ist die Banalität des Lebens. Machen wir uns nichts vor.
Und lassen wir uns davon nicht entmutigen. Diese ganze mediale Welle mit
ihrer Verharmlosungstaktik hat die kollektive Erinnerung nicht verändert.
Sie hat nur denen, die an einen anderen Staat denken als ich, wenn das Wort
DDR fällt, ein neues Selbstbewusstsein gegeben. Es ist nichts
Ungewöhnliches, dass Leute den kritischen Blick auf Zeiten meiden, die sie
nicht wie mutige Helden aussehen lassen. Und obschon es moralisch schwach
ist nach 15 Jahren Bedenkzeit, gehört Verdrängen doch zum Alltag. Nur
sollten wir uns immer vergegenwärtigen, dass dieser schmerzlindernde
Mechanismus, wie Jean Améry einst sagte, nur Tätern zur Verfügung steht -
aber daran darf die Natur eines terrorisierenden Staates nicht gemessen
werden. Offenbar gibt es heute unter Teilen der deutschen Bevölkerung (auch
im Westen!) das Bedürfnis, sich mit der DDR an ein Land zu erinnern, in dem
es keine Schlangen vor dem Konsum gab, keinen alltäglichen Versorgungskampf,
kein monatelanges Warten auf den Klempner, keine erniedrigende
Eine-Hand-wäscht-die-andere-Unkultur, keine Stasi-Knäste und
Häftlingsfreikäufe, ein Land ohne Kachelöfen, ohne stinkende Autos, ohne
Eingesperrtsein, Mauertote und Bevormundung, kurz ein Land, das viel freier
und offener daherkommt, als es der ganze fiese graue Osten tatsächlich war.
Ich frage mich, wie viel Nordhäuser Doppelkorn man eigentlich kippen muss,
damit man das ernstlich glaubt. So besoffen kann sich doch nicht mal Egon
Krenz trinken.
Nein, wir, die wir die Wahrheit besser kennen, sollten gegen dieses Leugnen
am besten vorgehen, indem wir von unseren Biografien erzählen und nicht
aufhören zu zeigen, dass die DDR auch aus einem 15-Jahre-Rückblick kein
Kuschelstaat mit Zukunftsoption war, sondern ein zynisches, verlogenes
System, in dem die spießigen Villen von Wandlitz noch das kleinste Übel
darstellten. Wenn man immer wieder darauf verweist, geht es nicht um
Verdammung des stattgefundenen Lebens (das ist eine dumme Behauptung aus der
Agitpropschublade des "Neuen Deutschlands"), es geht nur um differenzierte
Auseinandersetzung. Das Leben hat viele Farben, natürlich, auch und gerade
in einer Diktatur. Aber deswegen bleibt sie doch immer eine Diktatur. Das
ist keine Frage der Erinnerung, es ist, wie damals, eine des Standpunkts.
Eine Journalistin fragte mich einmal, wie ich den 3. Oktober begehen würde.
"Den 3. Oktober? Gar nicht", antwortete ich. "Nie?", hakte die Reporterin
nach. "Ja, doch", fiel mir dann ein, "1990. Da war ich bei Freunden auf dem
Land, und wir haben Kohlsuppe mit Birnenkompott gegessen." So war es. Ich
hatte es fast vergessen. 3. Oktober 1990, mit Kohlsuppe in die
Marktwirtschaft! Mehr als Themen-Essen habe ich dem glücklichen
Zusammenfinden des alten Reichs damals nicht abgewinnen können.
Diese ganze deutsche Einheit war mir fremd. Ich hielt sie nicht nur für
verfrüht, ich hielt sie vermutlich sogar für komplett falsch. Ich weiß es
nicht mehr genau. Ich weiß nur noch, dass ich innerlich dagegen war. Heute
bin ich heilfroh über den Lauf der Dinge. Die rasche Wiedervereinigung war
vermutlich der Lottogewinn meines Lebens. Aber 1990 wollte ich etwas halten,
das unhaltbar war. Ich wollte eine DDR, wie ich sie mir immer gewünscht
hatte: reformiert, demokratisch, gerecht. Was für eine Illusion! Heute weiß
ich das. Nur erinnere ich mich nicht gern daran, weil ich mir töricht
vorkomme. Aber genau darin liegt das versöhnliche Moment, das ich dem
Verzweifeln entgegenstelle: Wenn wir vom Erinnern sprechen, dann gehen wir
nämlich meist leichtfertig darüber hinweg, dass ein Teil der Erinnerung eben
immer auch das Vergessen ist.
von Claudia Rusch